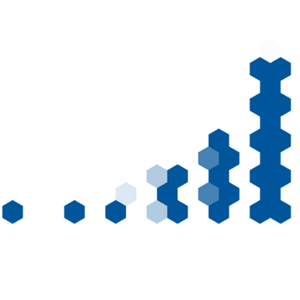Im April 2012 hat mich Philip Banse für die Heinrich-Böll-Stiftung interviewt. Das Interview ist Teil der Publikation "Öffentlichkeit im Wandel - Medien, Internet, Journalismus", die man auch als PDF herunterladen kann. Das Interview kann man auch auf SoundCloud anhören.
Im Interview spreche ich über die Disruptionen im Journalismus. Über das geschäftsmodellformende Element des Sharing:
Die Distributionsmöglichkeiten durch die Leser sind im Vergleich zur Situation vor zehn Jahren explodiert. Man könnte als grobe Faustregel sagen: Die Opportunitätskosten für Paywalls steigen umso mehr, je stärker die Vernetzungsmöglichkeiten werden.
Das mit Facebook und co. immer effizienter werdende Verteilen von einzelnen Artikeln verstärkt auch das im Interview angesprochene Gefangenendilemma bei Paywalls.
Versucht man, die Frage nach der Zukunft des Journalismus zu beantworten, muss man sich von den bestehenden Institutionen und ihren Prozessen erst einmal lösen und zunächst fragen, welche gesellschaftliche Aufgabe der Journalismus eigentlich erfüllen soll:
Was sind die gesellschaftlichen Aufgaben des Journalismus? Hier gehört natürlich auch Entertainment dazu, aber vor allem geht es darum, Informationen sichtbar zu machen, Kontext herzustellen und zu erklären – um der Gesellschaft Werkzeuge in die Hand zu geben, mit denen sie sich besser organisieren kann. Und wir beobachten zunehmend, dass dies über andere Prozesse geleistet wird als durch Verlage, also Unternehmen mit kommerziellen Interessen.
Bei der unvoreingenommenen Beantwortung dieser Frage stellen wir dann fest, dass auch Wikipedia und Guttenplag journalistische Aufgaben erfüllen. Über Guttenplag:
Mehrere Punkte sind daran interessant: Zum Einen der Prozess. Er war nicht kommerziell, sondern kollaborativ und allmendebasiert – die Ergebnisse standen jedem offen, niemand hat gesagt: Das ist jetzt mein geistiges Eigentum. Es war offen zugänglich und die Leute, die das gemacht haben, wollten das auch. Ich finde, dass es eine unglaubliche investigative Leistung ist, die dort erbracht wurde. Wir müssen auch festhalten, dass kein Verlag heute dazu in der Lage gewesen wäre, die notwendigen Mittel bereitzustellen, um das so umfassend zu recherchieren – und auch früher dazu nicht in der Lage gewesen wäre. Es ist also ein ganz neues Modell der Zusammenarbeit und der Informationsfindung möglich geworden, und ich glaube, dass das eine von vielen, vielen Antworten auf die Frage ist, wohin sich die Erfüllung der gesellschaftlichen Aufgabe des Journalismus entwickelt.
Es gibt zwei, oft zusammen auftretende, Faktoren, die man bei der internetgetriebenen Disruption nicht nur des Journalismus beobachten kann, die Verschiebung des Zahlungszeitpunkts und die Auswirkungen der Vernetzung an unterschiedlichen Stellen. Wie etwa am Beispiel spot.us:
Zum einen verschiebt sich das Bezahlen auf der Zeitskala, in der die Produktion stattfindet. Zum Anderen spielt die Vernetzung an unterschiedlichen Punkten eine Rolle: Wenn ein Verlag einen Artikel veröffentlicht, wird er oft erst populär, wenn er in den Netzwerken verteilt wird. Die Distribution übernehmen also die Leser, die Vernetzung ist dem Konsum nachgelagert. Hier aber setzt die Vernetzung noch vor der Produktion ein, wenn die Nutzer sagen: Wir wollen, dass das untersucht wird, also bezahlen wir vorher.
Nimmt man das alles und verbindet es mit der Tatsache, dass (ehemalige) Verlage wie die Axel Springer AG dabei sind, ihre Produktteile zu entkoppeln..:
Früher war Werbefinanzierung direkt an das Presseprodukt gekoppelt, es war ein festes Bündel. Man musste gezwungenermaßen den Journalismus mit produzieren, um über Werbung Geld einzunehmen. Wenn nun aber ein großer Konzern sein Kleinanzeigenportal von seiner Online-Publikation losgelöst hat, findet ja auch die Kostenrechnung vollkommen anders statt. Wenn es entkoppelt ist, lässt sich natürlich sagen: Wir können mit diesem Anzeigenportal genauso gut oder viel mehr verdienen, warum sollen wir dann unsere Publikation, die keinen Gewinn abwirft, damit noch quersubventionieren?
..dann ist die Handlungsempfehlung aus dieser Entkoppelung und den vorher genannten Entwicklungen für die Politik offensichtlich: Keine Gesetzgebung für diese sich bereits vom Journalismus wegbewegenden Institutionen, wenn das Ziel eine Stärkung des Journalismus sein soll. Ganz besonders dann nicht, wenn diese Gesetzgebung gleichzeitig die neu entstehenden Formen behindern würde. Stattdessen sollte eher darauf geschaut werden, wie man den Journalismus selbst unterstützen kann, in welcher Form auch immer er sich prozessual und organisatorisch neu manifestiert.
Hier das komplette Interview:
Philip Banse: Mein Eindruck ist, dass deutsche Verlage im Netz bislang sehr viel alten Wein in neuen Schläuchen verkauft haben. Die Inhalte ähneln denen, wie sie im Journalismus schon immer produziert wurden, werden nun aber auf neuen Vertriebswegen an die Leute gebracht. Ist dieser Eindruck richtig?
Marcel Weiß: Dem würde ich zustimmen. Wir sehen wenig Experimentierfreude bei den Verlagen in Deutschland. Auf den Webseiten erscheinen die Artikel so, wie sie auch in der Printausgabe geschrieben wurden, beim Format wird nicht viel gemacht. Es gibt Ansätze in Richtung Datenjournalismus bei Zeit Online, aber insgesamt passiert nicht viel. Man sieht es auch beim iKiosk des Springer-Verlags. Schon im Namen steckt: Wir machen das, was wir im Print machen, auch online. Es sind die gleichen Bündel, die gleichen Inhalte, die gleichen Prozesse. Man versucht, das Analoge mit dem Digitalem zu simulieren.
Viele Zeitungen versuchen auf Paywalls umzuschwenken, stellen also ihre Inhalte hinter Bezahlschranken, die mehr oder minder löchrig sind, etwa das Wall Street Journal, die Londoner Times, auch die New York Times. In Deutschland versucht es der Springer-Verlag mit dem Hamburger Abendblatt, der Berliner Morgenpost und bald auch Welt Online. Ist das eine vielversprechende Strategie?
In den USA haben die Zeitungen relativ früh angefangen, ihre kompletten Printinhalte auch online zu stellen. Nun wird in der Regel implizit angenommen, dass es in Deutschland ebenso ist, aber das ist nicht der Fall. Es gibt zwar die Printinhalte zum Beispiel der taz komplett online, aber ansonsten werden Printinhalte nur punktuell online gestellt. Thierry Chervel hat mehrfach darüber geschrieben, durch die tägliche Feuilleton- und Medienschau hat der Perlentaucher dort einen guten Überblick. Letzten Endes gibt es bereits eine sehr starke Paywall-Kultur. Wenn Printinhalte online verfügbar sind, dann oft zu horrenden Preisen pro Artikel, das höchste der Gefühle ist E-Paper.
Bei zusätzlichen Paywall-Strategien gibt es tatsächlich gerade einige Versuche. Die New York Times ist da prominent und hat eine sehr poröse Paywall aufgebaut, bei der man bis zu zwanzig Artikel – inzwischen wurde es halbiert – kostenlos lesen kann. Zumindest kurzfristig scheint das erfolgreich zu sein, was schon mehr ist, als man von den vorherigen Paywall-Versuchen sagen kann. Wie erfolgreich das langfristig sein wird, scheint nicht sicher. Es ist nicht so, dass man hier aus einer kompletten Umsonst-Kultur kommt. Immer wieder wurden Paywall-Strategien versucht und wieder aufgegeben, weil sie online nicht das Geld eingebracht haben, das mit Werbung eingenommen wurde. Aber gleich, wie wenig es mit Werbung ist – mit Paywall war es immer noch weniger.
In der Netzöffentlichkeit sind Artikel nicht mehr an ein Medium gebunden und können durch Netzwerkeffekte sehr schnell enorme Reichweite gewinnen. Bei Paywalls ist es manchmal schwierig, Artikel zu verlinken und zu verbreiten. Besteht ein Widerspruch zwischen der vernetzten Öffentlichkeit und Paywalls?
Auf jeden Fall. Die Distributionsmöglichkeiten durch die Leser sind im Vergleich zur Situation vor zehn Jahren explodiert. Man könnte als grobe Faustregel sagen: Die Opportunitätskosten für Paywalls steigen umso mehr, je stärker die Vernetzungsmöglichkeiten werden. Deswegen sind die Paywalls ja porös, weil sie die Verbreitung noch ermöglichen sollen. Man will den Kuchen behalten und ihn aufessen, sozusagen das Beste aus zwei Welten. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das letztlich sein wird.
Ist das nicht eine plausible Argumentation, wenn die Verlagen sagen: Wir produzieren Inhalte und stellen sie ins Netz, aber werbefinanziert funktioniert es für uns nicht mehr, deshalb wollen wir dafür Geld haben?
Das ist eine plausible und nachvollziehbare Situation, solange man als Unternehmen die Konkurrenz und den Markt ausblendet. Die Marktbedingungen haben sich verändert. Und man sieht auch: Wenn online tatsächlich investiert wird, kann es profitabel sein. Zum Beispiel beim Spiegel-Verlag mit einer sehr starken Online-Redaktion. Viele Inhalte stehen online, zum Teil etwas boulevardesk, aber man deckt auch eine große Bandbreite ab. Und es ist profitabel. Die Frage ist: Wenn ich zum Beispiel die Welt komplett offline nehmen würde oder hinter eine Paywall stecke, wie viele Leser sind bereit, dafür zu bezahlen, wenn sie einen Klick weiter den gleichen Nachrichtenüberblick kostenlos bekommen? Wenn es kostenlose Substitutgüter gibt, werden die Leute eher zu diesen Publikationen gehen. Selbst wenn alle Verlage sich heimlich absprechen würden – lassen wir mal das Kartellrecht außer Acht – und gemeinsam eine Paywall hochziehen würden, selbst dann hätten wir das alte Gefangenendilemma aus der Spieltheorie: Ein Verlag, der ausbrechen und auf Werbefinanzierung setzen würde, bekäme die Reichweite all derjenigen potenziellen Leser der anderen Publikationen, die nicht zahlungsbereit sind. Er könnte also enorm gewinnen. Es wird daher immer den Sog geben, dass zumindest ein paar Angebote ihren allgemeinen Nachrichtenüberblick kostenfrei anbieten, um die verfügbare Reichweite abzufangen.
Wenn man sich die Zahlen der New York Times ansieht, haben sie zwar Abos und Umsatz gesteigert, aber es gleicht nicht ansatzweise aus, was an Werbeeinnahmen im Print verloren gegangen ist. Viele Verlagsleute sagen das. Da stellt sich die Frage, wie Leistungen finanziert werden sollen, die Journalismus gesellschaftlich wertvoll machen – hier fällt das Stichwort investigativer Journalismus, der teuer ist, zeitaufwändig und so weiter. Wo siehst du Finanzierungsmöglichkeiten für diese wichtige Funktion des Journalismus?
Zum einen muss man zunächst festhalten, dass investigativer Journalismus stets nur einen kleinen Bruchteil des gesamten Journalismus ausgemacht hat. Zum anderen, dass all die Prozesse in Verlagen – Unternehmensstrukturen, die Einbindung in den Markt, Vertrieb etc. – aus einer bestimmten Zeit stammen und auf Print ausgelegt sind. Sie sind nicht eins zu eins auf das Web übertragbar. Eine regionale Tageszeitung versucht zum Beispiel über eingebundene Newsticker auch das Weltgeschehen abzudecken, weil sie natürlich nicht überall Korrespondenzen hat. Für den Abonnenten irgendwo auf dem Land aber ändert sich die Situation, wenn er im Netz auf Spiegel Online, Zeit Online, Süddeutsche.de oder auch Google News und so weiter zugreifen kann. Er braucht nicht die Webseite einer Regionalzeitung, um die Newsticker, die er auch anderswo lesen kann, ein weiteres Mal zu lesen.
Das heißt, dass ein regionaler Verlag mit seinem Angebot dem kompletten Markt und einem gewandelten Medienkonsum gegenübersteht und darauf reagieren muss. Er könnte zum Beispiel sagen: Ich konzentriere mich auf das, was meinen Lesern woanders nicht geboten wird. Die Prozesse wandeln sich radikal durch die Veränderungen im Marktumfeld. Darüber könnte man noch ganze Bücher schreiben.
Aber grundsätzlich sollten wir bei der Frage nach der Zukunft des Journalismus oder des investigativen Journalismus zunächst ein paar Schritte zurück gehen und fragen: Was sind die gesellschaftlichen Aufgaben des Journalismus? Hier gehört natürlich auch Entertainment dazu, aber vor allem geht es darum, Informationen sichtbar zu machen, Kontext herzustellen und zu erklären – um der Gesellschaft Werkzeuge in die Hand zu geben, mit denen sie sich besser organisieren kann. Und wir beobachten zunehmend, dass dies über andere Prozesse geleistet wird als durch Verlage, also Unternehmen mit kommerziellen Interessen. Wikipedia ist das offensichtliche Beispiel. Da werden jetzt viele die Hände über dem Kopf zusammen schlagen, aber es leistet ähnliches.
Um ein anderes, konkretes Beispiel zu nennen: Wir hatten die Geschichte der Doktorarbeit unseres ehemaligen Verteidigungsministers, Herrn Guttenberg. Die Süddeutsche hatte einen Artikel angeschoben: Da war ein Wissenschaftler, der ein paar Plagiatsstellen gefunden hat. Der Artikel hat das wiederholt und damit war es erst einmal gut. Dass Interessante ist, wie sich dann Leute gefunden haben und im GuttenPlag-Wiki all die Plagiatsstellen in enorm kurzer Zeit gesammelt haben. Noch während der Diskurs lief, konnte man kopfschüttelnd zusehen, wie es immer mehr wurden.
Mehrere Punkte sind daran interessant: Zum Einen der Prozess. Er war nicht kommerziell, sondern kollaborativ und allmendebasiert – die Ergebnisse standen jedem offen, niemand hat gesagt: Das ist jetzt mein geistiges Eigentum. Es war offen zugänglich und die Leute, die das gemacht haben, wollten das auch. Ich finde, dass es eine unglaubliche investigative Leistung ist, die dort erbracht wurde. Wir müssen auch festhalten, dass kein Verlag heute dazu in der Lage gewesen wäre, die notwendigen Mittel bereitzustellen, um das so umfassend zu recherchieren – und auch früher dazu nicht in der Lage gewesen wäre. Es ist also ein ganz neues Modell der Zusammenarbeit und der Informationsfindung möglich geworden, und ich glaube, dass das eine von vielen, vielen Antworten auf die Frage ist, wohin sich die Erfüllung der gesellschaftlichen Aufgabe des Journalismus entwickelt.
Nun lagen die Informationen hier offen zutage, es war eine Fleißarbeit, dass sehr viele Menschen sie in kurzer Zeit durchforstet und verglichen haben. Investigativer Journalismus ist aber auch häufig mit geheimen Informationen, guten Netzwerken und Informanten, mit viel Zeit- und Geldaufwand verbunden. Gibt es denn Modelle, die diese Funktion außerhalb etablierter Verlage wahrnehmen können?
In Deutschland nicht. In den USA gibt es ein paar Ansätze, etwa das stiftungsfinanzierte spot.us. Man kann als Reporter hingehen und sagen, dass man über dieses Thema recherchieren möchte oder Leser können sagen: Wir wollen, dass dieses und jenes einmal untersucht wird. Die potenziellen Leser finanzieren den Artikel oder die Reportage vor, dann wird der investigative Reporter aktiv und das Ergebnis wird entweder frei online gestellt oder auch an einen Verlag weiterverkauft. Das ist zum Beispiel ein Modell.
Hier zeigen sich Faktoren, die man oft beobachten kann: Zum einen verschiebt sich das Bezahlen auf der Zeitskala, in der die Produktion stattfindet. Zum Anderen spielt die Vernetzung an unterschiedlichen Punkten eine Rolle: Wenn ein Verlag einen Artikel veröffentlicht, wird er oft erst populär, wenn er in den Netzwerken verteilt wird. Die Distribution übernehmen also die Leser, die Vernetzung ist dem Konsum nachgelagert. Hier aber setzt die Vernetzung noch vor der Produktion ein, wenn die Nutzer sagen: Wir wollen, dass das untersucht wird, also bezahlen wir vorher.
Es kommen also neue Spieler, wie es immer so schön heißt, in diese Publikationswelt. Zum Teil Leser, zum Teil Blogs, zum Teil Projekte wie GuttenPlag, Recherchebüros wie ProPublica et cetera. Welche Rolle haben dann in Zukunft die Verlage?
Neben ihrer wirtschaftlichen Rolle wird auch ihre Bedeutung zurückgehen – es ist eine logische Konsequenz der Zunahme an Playern. Ich glaube, dass es einige wenige Verlage auch weiterhin geben wird, die einen Nachrichtenüberblick anbieten, der Kontext und auch Öffentlichkeit schafft – wobei es sich dennoch immer weiter verschiebt. Es wird in jedem Fall weiter Verlage geben, aber ihre Bedeutung als Produktionsform, als Unternehmens- und Publikationsform nimmt zumindest relativ ab – auch wenn sie nicht auf null sinken wird.
Wenn man die Verlage so hört, könnte man ja meinen, es geht ihnen wahnsinnig schlecht. Wenn man sich die Zahlen ansieht, zum Beispiel die des Springer-Konzerns, sieht man ein Rekordergebnis. Der größte Verlag in Europa macht ein Drittel seines Umsatzes im Internet. Relativ wenig mit Journalismus, sondern mit Immobilienbörsen, Partnerbörsen und dergleichen. Wenn früher die Verlagsprodukte über Werbung finanziert wurden, warum dann nicht heute journalistische Produkte über solche Angebote?
Das könnten sie machen. Aber sie sind ja gewinnorientierte Unternehmen. Früher war Werbefinanzierung direkt an das Presseprodukt gekoppelt, es war ein festes Bündel. Man musste gezwungenermaßen den Journalismus mit produzieren, um über Werbung Geld einzunehmen. Wenn nun aber ein großer Konzern sein Kleinanzeigenportal von seiner Online-Publikation losgelöst hat, findet ja auch die Kostenrechnung vollkommen anders statt. Wenn es entkoppelt ist, lässt sich natürlich sagen: Wir können mit diesem Anzeigenportal genauso gut oder viel mehr verdienen, warum sollen wir dann unsere Publikation, die keinen Gewinn abwirft, damit noch quersubventionieren?
Das ist auch für die Politik interessant: Wenn der Springer-Konzern seine Gewinne immer weniger mit Journalismus bestreitet und gar nicht mehr darauf angewiesen ist, weil er seine Anzeigenportale und Angebote unabhängig von den journalistischen Angeboten betreiben kann, dann ist es nicht sinnvoll, solchen Unternehmen zusätzliche Rechte zu geben oder Gesetze in ihre Richtung zu formulieren. Der Springer-Verlag ist schon jetzt schon nicht mehr darauf angewiesen. Und die Entbündelung zeigt meines Erachtens deutlich: Man sollte sich nicht zu sehr auf die heute etablierten Institutionen versteifen. Sondern lieber darauf achten: Wie findet der gesamte Prozess des Journalismus und die Aufgabenverteilung statt, was können wir da unterstützen?
Du sprichst das Leistungsschutzrecht an, dass die Verlage initiiert haben und von der Koalition angekündigt wurde. Es soll Verlagsprodukte im Internet besser schützen – nicht die Texte selber, sondern die Arbeit, die die Verlage für die Zusammenstellung, das Layout, die Überschriften etc. leisten. Aber auch die Verlage wie Springer sagen: Da wird nicht viel Geld bei herumkommen. Warum verfolgen Sie es dann weiter?
Langfristig, denke ich, geht es den Verlagen darum, dass sie ein Instrumentarium an die Hand bekommen wollen, mit dem sie neue Player im Markt kontrollieren können. Zu denen sie hingehen können und denen sie Bedingungen diktieren können, die sie vorher nicht diktieren konnten. Nun wird immer Google News vorgeschoben, ein großes Konzernangebot, auf dem nicht mal Werbung zu finden. Aber es geht natürlich auch ganz konkret um Startups und um neue Angebote in diesem Bereich, die dann nicht auf der Verlagsebene in der Wertschöpfung arbeiten, sondern auf anderen Ebenen. Zum Beispiel Commentarist, ein deutsches Startup, über das man als Leser Kolumnisten über verschiedene Publikationen hinweg folgen kann. FAZ und Süddeutsche drohten mit der Klage, woraufhin man diese Publikationen aus dem Angebot genommen hat – während andere Verlage sehr gern mitmachen. Es gibt also durchaus verschiedene Ansichten.
Grundsätzlich kann man sagen: Je mehr exklusive Rechte wir schaffen, ob Urheberrecht oder Leistungsschutzrecht, desto mehr stärken wir potenziell Unternehmen, die auf diese exklusiven Rechte setzen. Und desto mehr schwächen wir Prozesse wie sie im GuttenPlag-Wiki oder Wikipedia stattfinden. Also all das, was Yochai Benkler die Commons-based peer production genannt hat; wo Menschen zusammen kommen, lose miteinander arbeiten und das Ergebnis allen frei verfügbar ist. Wenn wir exklusive Rechte schaffen, behindern wir das. Das ist natürlich auch Sinn und Zweck der Sache.
Sollte man also einfach den Wagen laufen lassen und keine Gesetze wie das Leistungsschutzrecht verabschieden – oder kann man solche allmendebasierten, kollaborativen Prozesse gesellschaftlich befördern?
Ich glaube, dass es für die Politik sehr sinnvoll wäre, aus dem Weg zu gehen. Wir stehen in einer Zeit, in der wir als Gesellschaft experimentieren und viele Sachen entdecken. In der wir auf einmal feststellen: Das ist ja sinnvoll, aber man wäre nie selbst darauf gekommen. Wenn ein Politiker sagt, er könne das abschätzen, wir müssten jetzt dieses und jenes Recht schaffen, dann müsste er glaubhaft versichern können, dass er zum Beispiel Twitter vorhersehen konnte und dass es erfolgreich sein würde. Das sind Prozesse, die man nicht behindern will, weil sie auch gesellschaftlich sinnvoll sind. Ich würde dafür plädieren, dass wir exklusive Rechte wie auch das Urheberrecht weniger restriktiv gestalten, denn es würde zu einer besseren Informationsverteilung in der Gesellschaft führen. In einer vernetzten, kollaborativen Welt wären wir damit insgesamt besser gestellt.
Das Interview führte Philip Banse im April 2012 in Berlin.
(Das Interview steht wie die gesamte Publikation unter der CC-Lizenz By-Sa.)