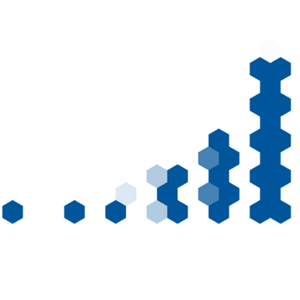Ben Thompson analysiert knallhart die Situation der Presseverlage:
newspapers are paying the price for having long ago divorced the cost of their content from the value readers place upon it. To put it another way, it’s not that “the Internet has unbundled advertising from content creation,” it’s that advertisers (rightly) don’t give a damn about journalistic ideals. It is incredibly tiring to hear newspaper defenders talk as if advertising dollars are their god-given right, and that Google and Facebook are somehow stealing from them, when in reality Google and Facebook are winning in the fairest way possible: providing better value for the advertiser’s dollar.
Betrachtet man die Diskussion hierzulande, kann man regelmäßig zu dem Schluß kommen, dass sowohl die Presseverleger als auch diejenigen, die meinen, ihnen gute Ratschläge zu ihrem Geschäft geben zu können, vollkommen verkennen, wie schwierig bis aussichtslos die Lage für fast alle Presseverlage sein wird.
Das Problem, das Dilemma hinter dem Buzzwort 'Disruption', liegt in der Unfairness der neuen Situation. Die Konkurrenz wird bestenfalls ignoriert weil sie nicht als Konkurrenz wahrgenommen wird:
You may consider the comparison unfair – an entire newsroom putting out a daily edition as compared to a solo blogger posting one article – but the unfairness is the point. No one shared my article because it was from Stratechery, but then again, no one shares an article today just because it’s from the New York Times; all that matters is the individual article and its worth to the reader and potential sharer. As a writer, this is amazing. When it comes to reader attention, I am competing on an equal footing with The New York Freaking Times! Unfortunately for The New York Times, when it comes to making money they’re competing with Google and Facebook. Most distressingly, though, when it comes to costs, they’re competing with the last 150 years. Everything from printing presses to sales and marketing is deadweight if advertising is not a sustainable model.
Die Chancen für Autoren1 sind enorm. In Deutschland könnten wir allerdings vor einer dunklen Zeit stehen, weil von den freiwerdenden Journalisten bisher kaum auch nur ein zartes Interesse daran zu erkennen war, die neuen Möglichkeiten beim Schopfe zu packen.2 Im Gegensatz, wie so oft bei diesen Themen, zu den USA natürlich.
Es ist vielleicht an der Zeit, die Bezeichnung 'Journalist' nicht mehr konstant zu benutzen, weil das damit verbundene mentale Bild Scheuklappen mit sich bringt. “Wie kann Journalismus überleben?” ist zum Beispiel bereits eine Frage, die dank ihrer irreführenden Prämissen nie zu der Antwort führen wird, die man eigentlich sucht. ↩
Stattdessen könnte man den Eindruck bekommen, dass jede Entlassungswelle im Printsektor dazu führt, dass die Betroffenen geschlossen in den PR-Bereich wechseln. Dieser Schritt ist nachvollziehbar, lässt aber auch Hunger auf Neues in der journalistischen Branche vermissen. Nebeneffekt: Die deutsche PR-Branche war noch nie so gut mit Kontakten zu den (noch) bestehenden Redaktionen ausgestattet. ↩