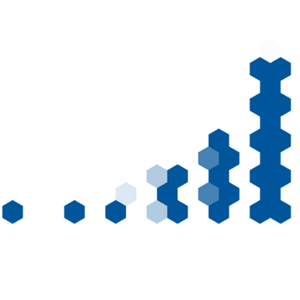Markus Reiter hat für die Stuttgarter Zeitung einen guten Artikel geschrieben ("Streit ums Urheberrecht: Auch kreative Arbeit ist: Arbeit"), in dem er sich kritisch mit den Positionen derer auseinandersetzt, die ein weniger restriktives Urheberrecht fordern.
Über die Geschichte des Urheberrechts schreibt er:
Die Kirche und die Fürstenhöfe fielen als Finanziers von Kunst und Kultur weg. Die Künstler verstanden sich fortan als Individuen, die für ihre Schöpfungen genauso bezahlt werden wollten wie die entstehenden Klassen der Arbeiter und Angestellten für ihre Tätigkeiten. Das Urheberrecht wurde zum Ausdruck künstlerischer Emanzipation und zur Befreiung aus der Abhängigkeit vom Mäzenatentum. Es unterwarf die Werke der Kunst und Kultur zugleich den Gesetzen des Marktes.
Das ist so nicht ganz richtig. Das Copyright, das Vorbild für das Urheberrecht, entstand wie auch letzteres, vor allem weil Buchverlage ihre Investitionen vor Nachdrucken schützen wollten. Die Emanzipation des Künstlers vom Mäzen war ein Nebeneffekt. Dafür hat sich der Künstler vom Rechteverwerter abhängig gemacht. Denn ohne diesen konnte er nun nicht mehr von der Kunst leben.
Es ist übrigens nicht so, dass der Markt, mit dem Verwerter als Flaschenhals (oder als 'Gatekeeper'), automatisch immer besser für die Kultur ist als der Mäzen. Als Beispiel sei hier etwa die Band The Velvet Underground genannt. Ohne ihren Mäzen Andy Warhol hätte die Band niemals ihr erstes Album aufgenommen. Dieses Album ist kommerziell gnadenlos gefloppt. Brian Eno hat Jahrzehnte später über das Album gesagt, dass jeder der wenigen, die es gehört haben, anschließend eine Band gegründet hat.
Nichtsdestotrotz sind einzelne Mäzene sicher nicht die Zukunft der Kulturfinanzierung. Was aber wichtig ist: Man sollte die industrielle Produktion von Kultur nicht idealisieren.
Ein nachgedrucktes Buch oder eine nachgespielte Sinfonie hingegen fehlt niemandem: Es minder weder die Existenz noch die Qualität des ursprünglichen Werkes. Genau dieses Argument greifen die Gegner des Urheberrechts im 21. Jahrhundert erneut auf. Man könne doch, sagen sie, heutzutage ein Musikstück beliebig oft ohne Qualitätsverlust, ohne Aufwand und fast ohne Kosten kopieren, anders als noch vor wenigen Jahren und Jahrzehnten, als es an eine DVD oder Musikkassette gebunden war.Dabei vergessen sie, dass es dem Urheberrecht schon im 19. Jahrhundert nicht um den materiellen Träger der schöpferischen Leistung ging. Es kümmerte sich nicht um die Leinwand, das Notenblatt oder das gedruckte Buch. Der Diebstahl dieser Dinge fiel ohnehin unter das Strafrecht. Vielmehr sollten die Verwertungsrechte an den kreativen Produkten geschützt werden.
Ja, das Urheberrecht schützt nicht den Träger sondern das immaterielle Werk. Aber: das macht es nur, um den physischen Träger wertvoller zu machen, weil der Träger das Werk verbreitet.
Das ist sinnvoll, wenn wir Unternehmen für die Distribution der Kultur brauchen. Die brauchen wir heute aber nicht mehr.
Das ist ja das Problem, über das wir reden:
Distribution (Verkauf von CDs) und Produktion des Werkes (Album aufnehmen) waren in der industriellen Gesellschaft untrennbar miteinander verbunden.
Heute können wir Kunden, wir Leser, Hörer und Fans die Distribution in die eigenen Hände nehmen. (Filesharing)
Aus 1. und 2. entsteht der Konflikt. Denn hier bricht einer Industrie ihre Prozessgrundlage und damit ihre Geschäftsgrundlage weg. Die Künstler, die Kreativen sind nur getroffen, weil sie von den Geschäftsmodellen der Verwerter abhängig sind.
Das müssen sie aber nicht sein.
Denn welcher Schöpfer kann einen Roman, ein Musikstück, einen Bauplan noch verkaufen, wenn andere – ohne die Mühe, diese Werke zuvor selbst geschaffen haben zu müssen – kostenfrei über sie verfügen dürfen?
Falsche Frage. Die Implikation ist, dass die Schöpfer von Werken nur mit dem direkten Verkauf dieser Werke Geld verdienen können. Tatsächlich argumentieren viele (wie ich), dass der direkte Verkauf von Werken keine Zukunft hat, weil sie losgelöst von den physischen Trägern auf ihre Grenzkosten von Null reduziert sind.
Immaterielle Güter ohne physische Träger, die sie mit ihren Kosten auf eine Ebene mit anderen physischen Gütern ziehen, sind per Definition keine knappen Güter mehr. Geschäftsmodelle müssen aber immer auf knappen, nachgefragten Gütern basieren.
Auffallend wenige hauptberufliche Musiker, Designer, Fotografen, Architekten und Autoren sind heute auf der Seite der Urheberrechtsgegner zu finden. Kein Wunder: sie sind eben nicht nur Nutznießer, sondern Schöpfer kreativer Leistungen. Mit den Erlösen ihrer geistigen Arbeit müssen sie Brot, Milch, Miete und den Latte macchiato bezahlen.
Praktisch jeder Bürger ist heutzutage auch ein Urheber.
Ich bin ein Urheber, der zu einem großen Teil von seinen Werken lebt, und bin für eine Reform des Rechtes, welche es weniger restriktiv macht. Wahrscheinlich macht mich das zu einem "Urheberrechtsgegner". Ich glaube, dass es viele Urheber gibt, die ähnlich denken, die sich aber nicht in offenen Briefen oder Verbänden zusammenfinden, weil das eine Ansicht ist, die sich eher bottom-up verbreitet, während eine Position "Pro starkes Urheberrecht" eher top-down Verbreitung findet, weil sie im Sinne von rechteverwertenden Konzernen ist.
Oder anders: Alles war Konzernen hilft, wird immer mehr Öffentlichkeit bekommen, weil es mehr Leute (Lobbyisten) im Hintergrund gibt, die diese Agenda pushen. Alles, was Bürgern allgemein oder Urhebern helfen würde, allerdings eher indirekt und weniger direkt zuordnungsbar, wie etwa ein weniger restriktives Urheberrecht, das auch Urhebern mehr Handlungsspielraum mit bestehender Kultur geben würde, hat keine streng durchorganisierte und damit effiziente Lobby. Deswegen wird ein Konzernmanager eher gehört als ein Kreativschaffender oder ein 16jähriger.
Nur die Wahlergebnisse der Piraten sprechen eine klare Sprache: Deutschland besteht nicht allein aus Konzernmanagern.
Dass so wenige Urheber "auf der Seite der Urheberrechtsgegner" zu finden sind, hat noch andere Gründe. Denn die meisten haben
a.) kein ökonomisches Grundwissen,
b.) daran auch kein Interesse,
und c.) glauben leider zu oft jedem dahergelaufenen Lobbyisten, der auf Ressentiments und Bauchgefühle zielt. (weil es einfach ist, besonders wenn es um Themen geht, mit denen man sich nicht befassen will)
Deswegen findet man auch nicht nur wenige Kreativschaffende, die eine andere Position als die der Verwerter einnehmen. Man findet deswegen auch wenige, die überhaupt eine Position haben, die auf Kenntnis basiert. Und ja, das ist tragisch.
Diese Woche war ich auf einer kleinen SPD-Veranstaltung, auf der auch einer der Tatort-Autoren gesprochen hat. An einem Punkt sagte er sinngemäß, dass er nur Geschichtenerzähler sei und davon leben will und sich aber andere Menschen Gedanken machen sollen, wie das Geld dann reinkommt. Damit wolle er sich nciht beschäftigen.
Das dürfte leider die Position vieler Kreativschaffender zusammenfassen.
Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt: Cory Doctorow, Neil Gaiman, Tim O'Reilly oder Paulo Coelho sind die bekanntesten Urheber, die sich recht klar auf die Copyleft-Seite geschlagen haben. (Es gibt weitaus mehr. Leider nicht so viele in Deutschland. Woraus man lesen kann, was man will.)
Argument 1 der Urheberrechtsgegner lautet: Da man illegales Kopieren technisch nicht vollständig verhindern kann, soll man es lieber gleich erlauben. Zweifellos müssen Rechte, darunter sogar Grundrechte, der Netznutzer eingeschränkt werden, wenn Rechte der Urheber durchgesetzt werden sollen. Allerdings gilt das für jede Rechtsnorm. Nehmen wir das Verbot der Steuerhinterziehung. Sie wird sich niemals vollständig verhindern lassen, und ihre Bekämpfung erfordert es, Grundrechte für einige Menschen einzuschränken. Dennoch käme niemand auf die Idee, Steuerhinterziehung deswegen zu legalisieren. Der Rechtsstaat darf vor Rechtsbruch nicht kapitulieren, sondern muss eine Balance von Freiheit und Überwachung finden.
Zwei Dinge sind anzumerken: Erstens handelt es sich bei illegalem Filesharing und anderen Urheberrechtsverletzungen in der Regel um unautorisierte Distribution. Im Gegensatz zu Diebstahl oder Steuerhinterziehung hat diese nicht nur negative sondern auch positive Effekte.
Zweitens stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Um diese unautorisierte Distribution, die die direkte Folge eines systemischen Merkmales ist, wirklich einzudämmen, muss zwangsläufig private Kommunikation im Netz aufgegeben werden.
Die Loslösung der Werke von ihren physischen Trägern ist ein Paradigmenwechsel mit fundamentalen Folgen. Davor darf man nicht die Augen verschließen.
Das bedeutet, dass man sehr wohl fordern kann, dass das alles eingedämmt wird. Damit untrennbar verbunden ist dann aber auch eine Rechtfertigung der entstehenden Kollateralschäden. Kein YouTube, kein Tumblr, kein Pinterest etc. pp., so wie wir sie heute kennen.
Ich verfolge die Debatte (hier in Deutschland ist es bisher eher ein Streit) sehr genau und ich habe bis jetzt noch nicht einmal gesehen, dass diese gesellschaftlichen Kollateralschäden tatsächlich abgewogen werden. Jeder kann im luftleeren Raum etwa fordern.
Argument 3 lautet: Das Geschäftsmodell, das hinter dem Urheberrecht steht, ist durch das Internet zusammengebrochen. Pech gehabt! Sucht euch ein neues! Es geht aber nicht um ein Geschäftsmodell, sondern um einen Rechtsrahmen. Ein Vergleich: wenn Kaufhäuser in Schwierigkeiten geraten, weil die Konsumenten lieber im Internet einkaufen, mag das für die Mitarbeiter und für die Innenstädte bedauerlich sein – aber es ist eben nur das Ende eines Geschäftsmodells. Wenn man aber plötzlich das Prinzip infrage stellen würde, überhaupt Waren gegen Aussicht auf Profit zu verkaufen, gäbe es ein Problem – und recht bald eine Mangelwirtschaft.
Das Argument lautet eher so: Wenn wir uns zwischen eurem Geschäftsmodell und unserer Privatsphäre entscheiden müssen, dann entscheiden wir uns für unsere Privatsphäre.
Wenn ein Geschäftsmodell nur durchsetzbar ist, wenn die komplette Bevölkerung unter permanente Beobachtung gestellt wird, weil sie die verkaufte Leistung selbst erbringen kann (wir erinnern uns: Distribution und Produktion sind industriell gekoppelt worden), dann sind das zu hohe gesellschaftliche Kosten, um dieses Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten.
Oft schieben die Urheberrechtsgegner nach, Musiker sollten live spielen, um ihr Geld zu verdienen. Auch hier ist die Perspektive vom Egoismus der Rechtepiraten geprägt. Weil es ihnen vor allem um den kostenlosen Musikdownload geht, ignorieren sie andere Kreative wie Fotografen, Komponisten, Designer, Architekten und Filmschauspieler, die ihre Arbeit nicht einfach bei Liveauftritten präsentieren können.
Liveauftritte sind nur ein Beispiel für knappe Güter. Das Prinzip bleibt für alle auf einem Markt teilnehmende Parteien gleich. Filmschauspieler präsentieren ihre Arbeit übrigens bereits seit längerem auch live: Das nennt sich dann Theater.
Argument 4 lautet: „Im Allgemeinen wird für die Schaffung eines Werkes in erheblichem Maße auf den öffentlichen Schatz an Schöpfungen zurückgegriffen. Die Rückführung von Werken in den öffentlichen Raum ist daher nicht nur berechtigt, sondern im Sinne der Nachhaltigkeit der menschlichen Schöpfungsfähigkeiten von essenzieller Wichtigkeit.“ So drückt es etwas ungelenk das Parteiprogramm der Piraten aus. Gemeint ist: irgendwie gehören geistige Güter doch allen, weil alle kulturellen Leistungen auf den Schultern von Giganten ruhten. Damit werden die Musik von Lady Gaga und Justin Bieber, der jüngste Hollywoodfilm und das coole Videospiel zum Erbe der Menschheit erklärt und deren kostenlosen Download zum Menschenrecht. Dieses Argument ignoriert, dass das Urheberrecht kreative Leistungen vergütet. Diese zu erbringen, ist mit Kosten, Zeit und Mühe verbunden.
Wie seit Jahren Kritiker des aktuellen Rechtes immer wieder betonen: Copyright und Urheberrecht sind geselleschaftliche Kompromisse. Es werden zeitlich beschränkte Monopolrechte gewährt, die einen Investitionsschutz bieten sollen, damit sich Kosten, Zeit und Mühe lohnen. Darüber hinaus dürfte es unter vernünftigen Menschen unstrittig sein, dass der Nutzen der Gesellschaft an bestehenden Werken steigt, je eher diese in die Gemeinfreiheit übergehen.
Letztlich machen sich die Urheberrechtspiraten mit ihrer Forderung nach unbedingter Freigabe aller Kunst zu unfreiwilligen (oder freiwilligen?) Lobbyisten von milliardenschweren Internetkonzernen wie Google und Apple.
Jetzt auch Apple? Was haben die mit alledem zu tun? Zum Google-Standardvorwurf, ein wirklich komplett unsinniges Argument, schrieb ich vor wenigen Tagen:
Sobald über ein weniger restriktives Urheberrecht gesprochen wird, das auch der gesamten Gesellschaft und nicht nur dem rechteverwertenden Monopolisten zugute kommt, wird Nähe zu und Unterstützung von Google vorgeworfen.Das ist absurd.
Wenn jeder von einem weniger restriktiven Urheberrecht profitiert, dann eben auch Unternehmen, und dann gehört dann eben auch Google dazu. Alles, was Google, Facebook oder andere Webdienste innerhalb des geltenden Rechtes machen, können auch andere Unternehmen, können auch Presseverlage, Filmstudios und, ja, sogar freie Journalisten machen.
Selbst die besten Kritiker der Urheberrechtskritiker scheinen vor ein bisschen Demagogie nicht gefeit zu sein. Schade.
***