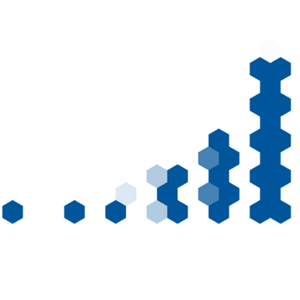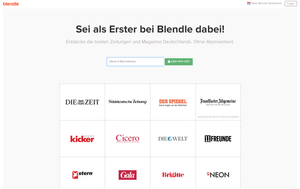Blendle ist diese Woche in Deutschland gestartet und hat enorme mediale Aufmerksamkeit erhalten. (Google News zählt zum Start allein über 70 Artikel.) Kein Wunder, wenn alle großen Publikationen beim "iTunes für Zeitungsartikel" dabei sind.
Ich hatte bereits Ende August geschrieben, dass ich bezweifle, dass Blendle massgebliche Gelder in die Kassen der Presseverlage spülen wird.
Gründe dafür gibt es viele. Ein Grund, der schon immer gegen Micropayments für Presseartikel sprach, liegt in den Transaktionskosten für Micropayments. Niedrige Preise sind mit Transaktionskosten verbunden, die sehr viel mehr über die eigentliche Transaktion bestimmen als der eigentliche bezahlte Preis. In diesem Fall kommen, wir haben das hier und anderenorts bereits unzählige Male durchgespielt, auch noch mentale Transaktionskosten, wie es u.a. Clay Shirky 2003 nannte, hinzu:
The people pushing micropayments believe that the dollar cost of goods is the thing most responsible for deflecting readers from buying content, and that a reduction in price to micropayment levels will allow creators to begin charging for their work without deflecting readers.
This strategy doesn't work, because the act of buying anything, even if the price is very small, creates what Nick Szabo calls mental transaction costs, the energy required to decide whether something is worth buying or not, regardless of price. The only business model that delivers money from sender to receiver with no mental transaction costs is theft, and in many ways, theft is the unspoken inspiration for micropayment systems.
Für Informationsgüter kommt zusätzlich ein Paradoxon hinzu, das die mentalen Transaktionskosten erhöht: Erst nach dem Kauf und dem Konsum weiß man, ob das Produkt den Preis wert war.
Blendle, in das immerhin New York Times und Axel Springer 3 Millionen Euro investiert haben, rennt in dieses Problem der mentalen Transaktionskosten nicht nur hinein, es sieht sich auch einer verschärften Situation diesbezüglich ausgesetzt.
So schön es ist, wenn ich nun das fulminante Essay oder das eindrucksvolle Dossier aus der Zeitung kaufen kann — wie zufrieden bin ich noch, wenn ich dann feststelle, dass ich das Stück auch kostenlos online hätte lesen können, vielleicht sofort, vielleicht ein paar Tage später? Weicht das angenehme Gefühl, sich auf einer Plattform zu bewegen, in der man guten Journalismus entdecken kann, dann nicht dem Eindruck, dass man immer wieder unnötig Geld ausgibt? Konsequent wäre es, wenn Verlage, die ihre kostenpflichtigen gedruckten Inhalte über Blendle anbieten, sie nur noch in Ausnahmefällen frei online stellen — aber dafür möchte ich aus Leserperspektive (und als Journalist, der sich möglichst viele Leser für seine Artikel wünscht) auch nicht plädieren.
Dieser Kontext der Ungewissheit und Undurchschaubarkeit für die Leser erhöht die mentalen Transaktionskosten enorm und wird den Kauf im Alltag schlicht unattraktiv machen, selbst bei Preisen pro Stück von weit unter einem Euro.
Selbst die Preisbildung bei Blendle erhöht die mentalen Transaktionskosten, statt Einheitspreise wie bei iTunes, darf hier jeder Verlag seine Preise selbst festlegen (bei Einheitspreisen hätten wohl kaum alle großen Presseverlage mitgemacht).
Benjamin O'Daniel über die Konsequenzen:
Für die Blendle-Leser wirken sich die unterschiedlichen Preise je Verlagstitel schnell im Portemonnaie aus. Wenn ein Nutzer zehn Spiegel- und SZ-Artikel liest, zahlt er dafür etwa acht Euro. Wenn er dagegen die Zeit und die Welt liest, kostet ihn das Vergnügen etwa drei Euro.
Eine andere Rechnung: An einem gemütlichen Sonntagnachmittag liest man gerne mal 20 Geschichten. Da macht es einen Unterschied, ob danach 5 Euro oder 15 Euro abgebucht sind. Wer jeden Sonntag „blendlen“ will, kommt bei 50 Wochenenden auf einen Unterschied von 500 Euro pro Jahr.
Das heißt, die unterschiedlichen Preise animieren zum vergleichen und mitrechnen. Entspanntes, zurückgelehntes Lesen fängt anders an.
Fazit: Die mentalen Transaktionskosten könnten bei Blendle nicht höher sein.
Warum funktioniert nun aber iTunes, also die entbündelten Micropayments, bei Musik? Die Antwort liegt im Unterschied dessen, was verkauft wird und folglich, wie es konsumiert wird.
Man liest selbst den besten journalistischen Text nur einmal. Musikstücke, vor allem die, die man sogar kauft, hört man öfter an. Noch wichtiger: In der Regel hat man den Song, den man kaufen will, bereits oft gehört -im Radio, auf YouTube, in einer TV-Serie-. Man kennt also schon das Informationsgut, das jetzt erworben wird und weiß bereits, dass es gefällt und den zu bezahlenden Preis wert ist. Das kann für journalistische Texte niemals gelten.
Und, auch wenn es sich bis zu denjenigen, die sich ein iTunes für journalistische Erzeugnisse wünschen, noch nicht herumgesprochen zu haben scheint: Das iTunes-Modell des Song-Verkaufs wird gerade im Massenmarkt von Streaming, also auf Geschäftsmodellebene vom Flatrate-Modell, abgelöst.
Das große Vorbild ist also kaum vergleichbar und wird zusätzlich gerade langsam aber sicher obsolet.
Interessanterweise erklärt der Blendle-Gründer Marten Blankesteijn im t3n-Interview, warum sie nicht auf Flatrates setzen (können):
Ich mag Flatrates – ich hätte sie gerne auch für Pubs, Supermärkte und Tankstellen. Aber in manchen Industrien funktionieren Flatrates einfach nicht für Lieferanten. Momentan ist das auch für Journalismus so. Wenn ein Zeitungsabo 30 Euro kostet, was würde passieren, wenn man für weniger gleich alle abonnieren könnte? Verleger glauben nicht, dass sich das für sie auszahlen kann. Und, ehrlich gesagt, würde ich am artikelbasierten Modell festhalten, sogar wenn Verleger uns erlauben würden, ein Flatrate-Modell zu probieren. Ich will auch Leute erreichen, die nur ein paar Euro pro Monat ausgeben wollen.
Die hohen Kosten und die damit verbundenen Strukturen der klassischen Presseverlage verhindern eine aggregierende Flatrate. Denn natürlich würde diese Flatrate sich nicht für die großen Presseverlage rechnen.
Die Erkenntnis daraus ist aber nicht, dass eine aggregierende Flatrate eine schlechte Idee wäre. (Sie könnte trotzdem eine schlechte Idee sein, vor allem marktübergreifend, aber aus anderen Gründen.)
Die Erkenntnis ist, dass die aus der Zeit der Papierdistribution kommenden Strukturen und Prozesse heute nicht mehr tragfähig sind.
Ich kann den Wunsch nach einer erfolgreichen Bezahloption für Presseerzeugnisse im Internet verstehen. Aber der Blendle-Ansatz ist wenn schon nicht zum Scheitern, dann mindestens zu einem "Ferner Liefen"-Platz im Erlösmix verdammt.
Da muss man auf die fehlende Rechtskonformität des aktuellen Kaufprozesses auf Blendle, der auf möglichst wenig zusätzliche Reibung ausgelegt ist, gar nicht erst eingehen. Ein Indiz dafür, dass alle Beteiligten beim Deutschlandstart nicht so genau hingeschaut haben und/oder den deutschen Onlinemarkt nicht gut kennen.
Die enorme Aufmerksamkeit, die Blendle erhält, ist erschütternd. Aber so zeigt Blendle zumindest eines: Die Debatte rund um den Medienwandel ist in Deutschland seit ihrem Anfang keinen Millimeter vorangekommen.