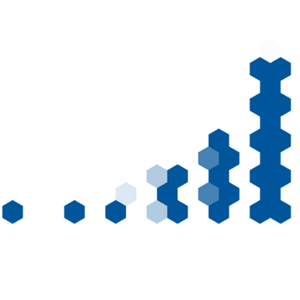"Wenn man sich Tageszeitungen und andere Websites anguckt, stellt man fest, dass sie mit Agenturen arbeiten, das ist trivial", sagt er und ergänzt: "In der Online-Welt gibt es überall Newsticker." Obwohl das Interview damit erst beginnt und noch mehrere Fragen und Antworten folgen, offenbart allein dieses Statement von Thomsen zusammen mit Niggemeiers Analyse das große Dilemma des Online-Journalismus: Die Austauschbarkeit der Portale. Was Stern.de-Chef Thomsen für eine geeignete Rechtfertigung hält, ist in Wahrheit das große Problem. [..]
Wo man im Print seine traditionsreichen Marken klar positioniert und deutlich gegeneinander abgrenzt, zeigt sich online nicht mal ansatzweise eine solch klare Differenzierung.
Die deutschen Portale der Presseverlage sind bisweilen komplett austauschbar, weil sie sich zu einem Großteil aus Agenturinhalten speisen und die eigenen Inhalte lediglich auf Papier veröffentlichen (oder zu horrenden Artikelpreisen). Stern.de ist ein besonders krasses Beispiel, wie Stefan Niggemeier aufzeigte.
Austauschbarkeit in den Inhalten, keine eigenständige Positionierung (von Bildergalerien, die Klicks aber keinen Mehrwert schaffen sollen, abgesehen), und eine Vermarktung, die in ihrer Papiersimulierung genau so schlecht ist wie der Rest des Angebots:
Kein Wunder, dass deutsche Presseangebote im Web nur 'digitale Pennies' verdienen, wie Verleger Hubert Burda einst beklagte.
Thierry Chervel vom Perlentaucher hatte bereits im Dezember letzten Jahres noch einmal aufgezeigt, das deutscher Verlagsjournalismus, von Verlagsvertretern als "Qualitätsjournalismus" bezeichnet, im Web praktisch nicht stattfindet:
Die aktuellen Ausgaben der Zeitungen stehen häufig nur zu einem sehr geringen Teil online.
Bei einer der besten deutschen Qualitätszeitungen, der Süddeutschen, dürfte Tag für Tag allenfalls ein Anteil von 5 Prozent der Artikel aus der Printzeitung ins Netz gestellt werden.
Was man als Online-Ableger der SZ im Netz sieht ist ein dürftiger Abglanz des Printinstituts. Meist handelt es sich um aktuelle Tickerverschnitte, ein paar Bilderstrecken und allenfalls hier und da ein Kommentar oder Leitartikel aus der gedruckten Ausgabe.
Bei der FAZ ist es genauso: Höchstens 5 Prozent der Printausgabe werden unserer Erfahrung nach online gestellt.
[usw.]
Es existiert praktisch kein von Presseverlagen betriebener Onlinejournalismus, zumindest nicht in den Ausmaßen, wie man es in den USA kennt. (Die taz ist komplett online frei abrufbar.)
Ist das gut so? Immerhin kann so die viel gefürchtete Kannibalisierung nicht stattfinden.
Die Verlage fordern trotzdem ein Leistungsschutzrecht. Fragt sich nur wofür.
Für die Demokratie an sich in unserem Lande und die Bedeutung in ihr, die sich die Presseverlage zum Teil zu recht zuschreiben, ist das auch interessant: Während in den USA die New York Times an der Spitze der reichweitenstärksten Online-Medienangebote steht, ist das bei uns Bild.de.
Deutschland, das Land der Dichter und Denker? Nicht online. Weil die deutschen Presseverlage ihre Inhalte und ihre Diskurse ausschließlich auf Papier verbreiten. (Ebenso interessant in Bezug auf den deutschen Unternehmergeist ist natürlich, dass es keinen reinen Online-Herausforderer in Deutschland gibt, der die Marktchance entsprechend nutzt. So wie sich etwa in den USA z.B. HuffPo und Politico in ihren Bereichen etablieren konnten.)
Was hat es für Auswirkungen auf das Land und seine Diskurse, wenn die heranwachsenden Generationen Inhalte zu aktuellen Debatten in ihrem bevorzugten Medium nur von Boulevard-Angeboten (Bild.de) und boulevardisierten Angeboten (Spiegel Online) vorfinden, während davon abgeschottet die Intellektuellen des Landes ihre Diskurse vor einem alternden Publikum in einem sterbenden Medium abhalten?
Insgesamt ist es bemerkenswert, wie weit die Realität von dem von Presseverlagsvertetern gezeichneten Online-Bild abweicht. Wenn man einen Schritt zurück tritt und die aktuelle deutsche Situation betrachtet, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus.