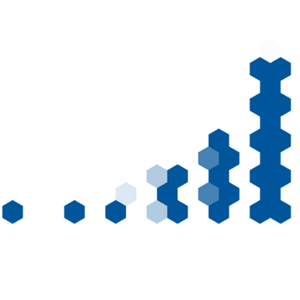Angesichts des bevorstehenden Endes der Frankfurter Rundschau und der Financial Times Deutschland wird in den Kommentaren der Zeitungen wieder viel über die Gratiskultur im Internet als ein vermeintlicher Grund für das Printsterben geschimpft. Wir haben dieses Strohmannargument hier und anderenorts bereits mehrfach als eben dieses offengelegt.
Da ich keine Lust habe, immer wieder die gleichen Argumente aufzuschreiben, gibt es im Folgenden auszugsweise meine Anmerkungen zur 'Gratiskultur' aus einem Text, der eine Reaktion auf ein Interview mit Mathias Döpfner im Handelsblatt im November 2010 war.
Döpfner und Handelsblatt: Der Aufstieg der Konkurrenz-Kultur — neunetz.com:
Unter Kosten führt also online leicht zum maximal niedrigsten Preis: Null. Mit diesem erreicht man die maximale Reichweite und kann (zum Beispiel) Werbung verkaufen. So wie man das bereits früher gemacht: Aufmerksamkeit verkaufen, maximale Reichweite mit Preisen pro Einheit die unterhalb der Kosten pro Einheit liegen.
Beim Preis selbst liegt der einzige Unterschied zwischen heute und vor dem Internet in der absoluten Höhe: Der Preis kann ohne weiteres auf Null sinken, weil die zugrundeliegenden Kosten es erlauben. Am relativen Verhältnis hat sich nichts geändert: Der Preis, den die Leser direkt zahlen, lag und liegt unter den Bereitstellungskosten.
Diese Dynamik einem schnäppchen-versessenen Konsumenten unterzuschieben, ist ein Strohmannargument. Aber, wenn die Presse schon immer so vorgegangen ist, wo liegt dann das Problem? Warum beschweren sich Pressevertreter wie Mathias Döpfner?
Weil online noch ganz andere Dynamiken entstanden sind, die den Presseverlagen tatsächlich zu schaffen machen. Auf der einen Seite ist die Anzahl der Werbeflächen enorm gestiegen. Werbekunden können heute über Google auf deren Suchseiten und auf Millionen von kleinen Websites werben. Facebook und andere neuartige Angebote nehmen zusätzlich Werbegelder ab. Angebote wie Immobilienscout24 oder Immonet und ähnliche Dienste in anderen Sparten graben das Geschäft mit Kleinanzeigen ab.
Damit nicht genug: Früher hatten Presseverlage oft lokale Monopole auf Werbeflächen. Sie konnten entsprechende Preise setzen. Die Presseverlage sind also nicht nur von mehr Konkurrenz bedrängt, sie sehen sich in vielen Bereichen historisch erstmals überhaupt Konkurrenz gegenüber.
Eines der Hauptprobleme der Presseverlage, um es kurz zu machen, ist also nicht, dass sie ihr Angebot unter Kosten an die Leser verbreiten, so wie sie es immer schon getan haben, sondern dass sie neuerdings mit Konkurrenz aus unzähligen Richtungen konfrontiert sind.
Aber wie soll man das alles knackig in der Öffentlichkeit verbreiten, wenn man gleichzeitig ein Artenschutzrecht für sich bei der Politik einfordert?
Von einer Konkurrenz-Kultur reden? Von einer Kultur des Wettbewerbs sprechen?
Nein, das geht natürlich nicht.