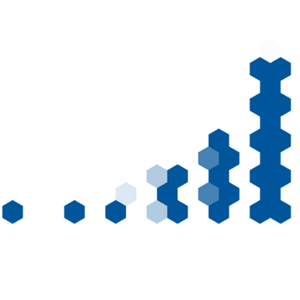Als ich neulich Clay Shirkys neues Buch Cognitive Surplus (Affiliate-Link)

las - Review des Buches folgt -, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Es existiert ein offensichtlicher Zusammenhang zwischen der öffentlichen Debatte zur Digitalisierung, der Existenz von Filesharing, dem Potential von Micropayment-Systemen wie Flattr und Kachingle und dem vorhersehbaren Misserfolg der meisten Versuche, Bezahlschranken zu errichten.
Seit einigen Jahren schreibe ich über die Verschiebungen der Kostenstrukturen, wenn die Wertschöpfung von analog zu digital wechselt. Die Tatsache, dass Vervielfältigung und Distribution von autonomen digitalen Gütern (i.d.R. Dateien) zu einem (Grenz-)Kostenpunkt von Null möglich sind, hat weitreichende Auswirkungen, derer sich eine Mehrheit der Gesellschaft - die digitale Gesellschaft eingeschlossen - noch gar nicht bewusst ist. Warum fällt es vielen so schwer, sich mit diesen Veränderungen anzufreunden?
Shirky beschreibt in Cognitive Surplus wie die Kosten, die für die industrielle Verbreitung von Informationen notwendig waren, unsere Vorstellung von Wert und Wertschöpfung und damit auch von Preisen und Bepreisung beeinflusst haben.
So schreibt Shirky auf Seite 49:
Scarcity is easier to deal with than abundance, because when something becomes rare, we simply think it more valuable than it was before, a conceptually easy change.
Wenn etwas also rarer wird, vermuten wir dahinter eine Steigerung des Wertes. Eine natürliche Reaktion. Sie spiegelt die analoge Welt wider, die Welt in der wir aufgewachsen sind.
Aktuell passiert aber folgendes: Viele Produkte oder handelbare Güter gehen in ihrer Verfügbarkeit von Knappheit zu Überfluss über. Logisch: Informationen, die früher über physische Güter transportiert wurden, liegen jetzt in ihrer reinen Form vor: Filme, Musik und Texte wurden früher mittels DVDs, VHS, CDs, Vinyl, Papier oder Steintafel verbreitet. Heute liegen sie alle mehr oder weniger in Dateiform vor. Dateien, die mit Grenzkosten von Null vervielfältigt und über das Netz verbreitet werden können.
Der 'Wert' der Filme, der Musik und der Texte hat sich nicht geändert. Wohl aber die zugrundeliegenden Kosten und damit auch, was man mit ihnen machen kann; was wirtschaftlich sinnvoll ist.
Shirky merkt zurecht an, dass Überfluss Experimente erlaubt; man kann jetzt vorher wertvolle weil teure Dinge so behandeln, als seien sie billig genug, um sie zu verschwenden. (ebenfalls S. 49)
Vielen Leuten fällt es aber schwer, sich damit anzufreunden. (Nicht zuletzt auch, weil viele falscherweise Preis und Wert gleichsetzen .) Sie nehmen die alten Rahmenbedingungen und wenden darauf basierende Erkenntnisse auf die neuen an, als hätte sich nichts geändert. Shirky:
Because abundance can remove the trade-offs we're used to, it can be disorienting to the people who've grown up with scarcity. When a resource is scarce, the people who manage it often regard it as valuable in itself, without stopping to consider how much of the value is tied to scarcity.
Wenn ich meine Musik oder meinen Film oder meine Publikation unter das Volk bringen wollte, musste ich hohe Investitionskosten aufbringen, um Kopien erstellen zu lassen und diese dann über den entsprechenden Vertrieb an die Geschäfte liefern zu lassen.
So eine Kostenstruktur mit ihrem hohen Risiko aufgrund der notwendigen Vorleistungen verlangt nach Profis. Deshalb gab es früher in diesen Bereichen kaum Amateure. Deshalb wurde früher vor der Veröffentlichung gefiltert und ausgesiebt und nicht danach.
Alles wollte gemanagt und bezahlt sein. Heute ist das nicht mehr nötig. Ob über Filesharing, Linksharung und/oder über Plattformen wie Youtube und co.: Die Trennung von Produktion und Distribution zieht sich wie ein roter Faden durch die Digitalisierung. Ich als Produzent kann in der Regel keine so effiziente Distribution sicherstellen, wie es andere, oft meine eigenen Leser, Nutzer, Fans, für mich erledigen können.
Die Implikationen sind relativ offensichtlich, werden aber trotzdem noch weitgehend ignoriert. Warum?
Weil wir, nach Shirky, mit historischen Unfällen aufgewachsen sind und diese oft ohne zu hinterfragen als gegeben hinnehmen.
Eine auf so einen Unfall basierende Annahme ist, dass das Publizieren an sich eine wertvolle, ernsthafte Tätigkeit ist. Ist es aber nicht. Wer vor dem Internet Inhalte veröffentlichen wollte - also vervielfältigen und verbreiten -, sah sich enormen Kosten gegenüber. Diese Kosten haben das Publizieren teuer gemacht, folglich musste man sich vorher genau überlegen, was überhaupt publizierenswert ist. Das Internet hat diesen Unfall, die nahezu untrennbare Verknüpfung von Publizieren und kostenintensivem Verbreiten, aufgehoben: Jeder kann ein Blog oder einen Account bei Twitter und co. anlegen und seine Inhalte mit einem Klick auf Publish veröffentlichen und verbreiten. Die Kostensenkung hat dazu geführt, dass das Filtern von vor dem Publizieren auf nach dem Publizieren verschoben werden konnte: Deshalb sind Online-Medien Filter und keine Gatekeeper . Und letztlich ist das auch schon immer sinnvoll gewesen, es war nur früher ökonomisch nicht tragfähig.
Der Akt des Publizierens an sich: nur aus Versehen teuer und damit als wertvoll betrachtet ('valuable').
Warum also für diese Tätigkeit bezahlt werden? Oder: warum für diese Tätigkeit bezahlen?
Flattr, Kachingle und co. sind die ersten genuinen Bezahlsysteme für diese Verschiebung in der Wertschöpfung:
- Sie senken die mentalen Transaktionskosten um der Kleinteiligkeit und hohen Verteilungsrate der Entstehungsorte zu entsprechen.
- Sie nehmen die Bezahlung nach dem Konsum vor, nicht davor.
Die Implikation: Man bezahlt nicht für das Publizieren sondern für das künftige Produzieren. Letztlich sind 'Spenden' auch genau das: Selbst wenn sie als Dankeschön gedacht sind, so sorgen sie bewusst oder unbewusst dafür, dass der Produzent weiter seiner Tätigkeit nachgehen kann - in welcher Form und welchem Umfang auch immer -. Allerdings wäre es für die Debatte rund um Systeme wie Flattr sicher sinnvoll, von der Bezeichnung als Spenden abzusehen, weil dieser Begriff hier etwas irreführend ist. (Auch wiederrum, weil viele Menschen freiwillige Zahlungen als Spenden noch im Kontext industrieller Wertschöpfung sehen und somit missverstehen können.)
Bezahlung lag schon immer in der Regel hinter der Produktion des Gutes, jetzt liegt sie zunehmend auch zeitlich hinter dem Konsum. Oder anders ausgedrückt: Schlicht vor der künftigen Produktion. (Die Produktion von Inhalten ist ein knappes Gut, das Publizieren und Verbreiten von Inhalten nicht. Bei der Konzeption von Geschäftsmodellen im Internet muss man immer die Unterscheidung zwischen knappen und nichtknappen Gütern einbeziehen.)
Bezahlschranken für Newsangebote dagegen etwa setzen vor dem Konsum an. Sie funktionieren nach der Logik der industriellen Rahmenbedingungen: Es kostet mich etwas, das bereit zu stellen, ich gehe ein Risiko ein, also Bezahlung vor Lieferung oder mindestens vor Konsum.
Bei der Auslieferung von Printpresse-Erzeugnissen war das gar nicht anders möglich: Die Finanzierung findet zwar seit Jahrzehnten mehrheitlich über Werbung statt, aber der Restposten von Kosten und Profit, der von den Konsumenten kommt - der Preis pro Kopie -, musste vor dem Konsum abgegolten werden. Die Distribution von Tageszeitungen etwa verschlingt schließlich eine Menge Geld und die Vervielfältigung will geplant und mit Vorschuss umgesetzt sein.
Online ist das aber nicht der Fall. Nicht nur sind die Distributionskosten und Vervielfältigungskosten der Newsseiten für die einzelnen Seitenaufrufe im Vergleich zu den anderen Kostenposten vernachlässigbar. Zusätzlich trennen Bezahlschranken auch noch mit ihrer Platzierung vor dem Konsum das Produkt von seinem wichtigsten Distributionskanal: Der Verbreitung durch die eigenen Leser.
Das Bezahlen bevor man wusste ob das Produkt überhaupt die erwartete Qualität hatte, war früher für Informationsgüter notwendig, weil sie an physische Güter mit ihren entsprechenden Kosten gekoppelt waren. Andere Geschäftsmodelle waren für die Anbieter oft nicht ökonomisch sinnvoll. Das ist heute nicht mehr so. Die Kopplung ist nicht mehr notwendig. Ohne die Kopplung sehen die zugrunde liegenden Kosten auf einmal komplett anders aus. Sie erlauben andere Herangehensweisen und nehmen den Konsumenten, Nutzern, Lesern, Hörern, Fans in der Regel das Risiko des (relativ) blinden Kaufs eines Magazins oder eines Albums ab. Wenn ich einen Artikel flattr, dann habe ich ihn bereits gelesen und für gut befunden.
Wenn ich einen Artikel bei faz.net und co. aus dem digitalen Archiv kaufe, weiß ich vorher nicht, ob der Artikel überhaupt die Informationen enthält, die ich erwarte. Das kann ich erst mit letzter Gewissheit wissen, wenn ich ihn gelesen also konsumiert habe. Dieses Risiko ist neben anderen Gründen ein wichtiges Hemmnis für Paid Content, das online mit frei zugänglichen und damit risikolosen Inhalten konkurriert. Dass die deutschen Presseverlage also ihre Inhalte mehrheitlich hinter Bezahlschranken verstecken, ist keine kluge Entscheidung.
Historische Unfälle haben unser normales Verhalten zurückgehalten. Ein Beispiel von Shirky für einen historischen Unfall (S. 101): Früher haben wir uns Telefonnummern eingeprägt, weil sie notwendig waren, um uns nahestehende Personen immer anrufen zu können. Aber wir haben das nicht gemacht, weil wir wollten sondern weil wir mussten. In dem Moment, in dem Telefonnummern in Mobiltelefonen abspeicherbar wurden, verschwand die Notwendigkeit, sich Telefonnummern einzuprägen. Das Einprägen der Nummern war eine unbequeme Notwendigkeit, kein natürliches Verhalten.
Wenn diese historischen Unfälle aufgehoben werden, wird das von ihnen zurückgehaltene Verhalten sichtbar, weil möglich (S. 101):
[..]
Those bits of new behavior, though, are extensions of, rather than replacements for, much older patterns of our lives as social creatures.
Filesharing: Unautorisiertes Filesharing existiert nicht, weil die heutigen Jugendlichen moralisch verwerfliche Egoisten sind. Generationen unterscheiden sich vor allem aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten, die sie in ihrer Zeit zur Verfügung haben, so Shirky. Sie unterscheiden sich nicht durch Charaktereigenschaften, die angeblich für alle Mitglieder einer Generation zutreffen, weil diese generationsvereinenden Eigenschaften gar nicht existieren.
Filesharing findet nicht statt, weil die heutigen Jugendlichen moralisch verfallen sind. Wenn das so wäre, dann wären auch Ladendiebstahl und andere Verbrechen ähnlich stark angestiegen. Der Grund wieder: Die Kostenstruktur digitaler Güter. Musik kann heute so leicht mit anderen geteilt werden wie Gedanken oder Telefonnummern. Reine Information. Dieser Umstand hat ein zutiefst menschliches Verhalten freigesetzt.
Man kann mit anderen etwas teilen, ohne dass einem selbst Nachteile entstehen. Weder muss man auf den jeweiligen Gegenstand verzichten, noch entstehen einem zusätzliche Kosten. Wer unter solchen Vorbedingungen nicht teilen will, erscheint als kein guter Mensch. Shirky (S. 125):
The decision not to make someone else's life better when it would cost you little or nothing has a name: spite. The music industry, in order to preserve its revenues, wanted (and still wants) all of us to be voluntarily spiteful to our friends.
Die Kostenverschiebung durch die Digitalisierung hat mit dem Möglichmachen von Filesharing also ein zutiefst menschliches Verhalten ermöglicht. Und das noch dazu in Verhältnissen, die in der industriellen Gesellschaft nur auf der Ebene großer Unternehmen möglich war.
Dieses Verhalten ist nicht revolutionär angehaucht. Da dieses Verhalten aber das Geschäftsmodell der Plattenlabel, die ihr Vorgehen, für die Weitergabe von Musikaufnahmen Geld zu verlangen, eins zu eins auf das Web übertragen wollen, untergräbt, muss es fälschlicherweise mit Diebstahl gleichgesetzt werden. Nur so kann man die Diskurs-Oberhand behalten.
Sowohl Geschäftsmodell der Plattenindustrie als auch das aktuelle Urheberrecht stehen also einem zutiefst menschlichem Verhalten diametral gegenüber, das durch industrielle Beschränkungen erst auf natürliche Art verhindert und jetzt durch die Digitalisierung in branchenerschütterndem Ausmaß ermöglicht wurde.
Fazit:
Für Geschäftsmodelle im Netz muss man sich lösen von Wertvorstellungen und Vorgehensweisen, die aus der analogen Welt stammen und ebenso vieles, was man als gegeben annimmt, gründlich hinterfragen. Die Verschiebung der Wertschöpfung löst durch ihre neue Flüssigkeit zwischen den Wertschöpfungsebenen historische Unfälle auf. Was vorher untrennbar verbunden war, wird in seine natürlichen Bestandteile aufgedröselt.
Das eigene Geschäftsmodell auf einen historischen Unfall aufzubauen, obwohl dieser obsolet wurde, ist keine gute Entscheidung. Natürliches menschliches Verhalten, das durch die Veränderungen möglich wurde, wird sich nicht einfach wieder abstellen lassen. Wozu auch?
Im Digitalen gehen die Veränderungen tiefer als den meisten klar ist. Denn viele wirtschaftlichen Vorgänge und gesellschaftlichen Vorstellungen basieren auf Knappheiten, die aktuell nach und nach wegbrechen. “Überfluss zerstört mehr Dinge als Knappheit.”
Weitere Artikel zum Thema:
- Warum Labels, Filmstudios und Verlage neue Geschäftsmodelle brauchen
- Shirky: “Institutionen werden versuchen, die Probleme zu erhalten, für die sie die Lösung sind.”
- “Verleger-Schreck” Flipboard: Auch auf Tablets gelten Marktdynamiken des Webs
- Sprachfehler: ‘Diebstahl geistigen Eigentums’ und ‘Kostenloskultur’
- Wenn unautorisiertes Filesharing Diebstahl ist, …
- Das deplatzierte Moral-Argument in der Filesharing-Debatte